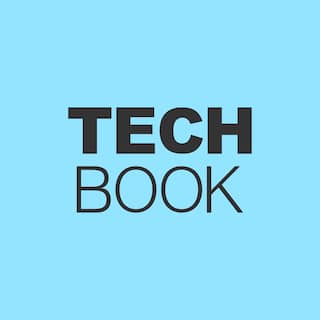
1. Mai 2023, 9:58 Uhr | Lesezeit: 7 Minuten
Elektroautos sind immer mehr im Kommen. Bereits in wenigen Jahren wollen die größten Unternehmen auf die reine Herstellung von E-Autos umschwenken. Nun fragen sich viele potenzielle Käufer sich, was sie beachten müssen. Welche Hersteller E-Autos verkaufen, was sie kosten und welche Besonderheiten es beim Kauf und bei der Nutzung gibt, erfahren Sie hier.
Ein Elektroauto ist längst keine Seltenheit mehr auf den Straßen und doch sind viele Käufer unsicher: Muss man beim Kauf eines E-Autos wirklich so viel beachten? Wie oft muss man das Auto laden und wo geht das? Fördert der Staat den Kauf? Sind E-Autos tatsächlich besser für das Klima? Und für welche täglichen Wege lohnt sich ein E-Auto? TECHBOOK klärt in diesem Kaufratgeber alle essenziellen Fragen und erklärt, worauf es beim E-Auto-Kauf ankommt.
Übersicht
Was ist überhaupt ein Elektroauto?
Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor wandeln Elektroautos elektrische in mechanische Energie um. Hierbei unterscheidet man zwischen Hybriden, sogenannten „Range Extender“-Autos sowie rein elektrischen Modellen:
- Rein elektrische Autos: Rein elektrische Autos – auch „Battery Electric Vehicles“ (BEV) – werden extern an Ladestationen, mobilen Ladegeräten oder privaten Wallboxen aufgeladen. Die Batterie speichert die Energie, speist das Fahrzeug damit und sorgt so für den nötigen Antrieb. Außerdem gewinnt das Auto Strom über die Rekuperation, bei der die Energie durch die Bremsung an den Akku zurückgeleitet wird.
- Hybride: Hybridfahrzeuge besitzen sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor und verbinden so klassische Antriebssysteme mit der elektrischen Variante. Dies hat den Vorteil, dass der Verbraucher sich nicht auf eine Variante beschränken muss, sondern je nach Strecke den passenden Energiegewinnungsprozess wählen kann. Hybrid Electric Vehicle (HEV) laden ihre Batterie über den Verbrennungsmotor sowie – mithilfe der Rekuperation – über die Bremsenergie auf. Bei einem Fahrzeug, das extern über das Stromnetz geladen wird, spricht man von einem „Plug-in-Hybrid Electric Vehicle“ (PHEV).
- Range Extender Autos: „Range Extended Electric Vehicle“ (REEV) besitzen zusätzlich zur Batterie noch einen Verbrennungsmotor mit Generator. Er unterstützt die Batterieleistung und erweitert so die Reichweite des Fahrzeugs. Im Gegensatz zu Hybrid-Modellen treibt die Batterie das Auto hier nicht direkt mit an; ansonsten ähneln sie sich.
Wichtige Komponenten eines E-Autos
Ein Elektroauto fährt mit einem Elektromotor, der durch den im Akku gespeicherten Strom angetrieben wird und elektrische Energie mithilfe von Magnetfeldern in mechanische Energie umwandelt. Der Akku versorgt außerdem Heizung, Klimaanlage und vieles mehr mit Energie und ist im Unterboden verbaut, sodass er von der Karosserie verdeckt wird. Wichtige Komponenten eines E-Autos sind folgende:
- Die Hochvoltbatterie: Die Hochvoltbatterie ist der Energiespeicher des Elektroautos und wird umgangssprachlich als Akku bezeichnet. Sie besteht aus Lithium-Ionen-Batterien, welche langlebig, aber auch kostspielig sind, viel Strom speichern können und schnell laden. Die Qualität des Akkus bestimmt maßgeblich den Preis sowie die Reichweite des E-Autos. Zudem ist die Hochvoltbatterie der Teil, der an der Ladestation angeschlossen und aufgeladen wird.
- Die Niedervoltbatterie: Diese ist für die Bordelektronik sowie die Speicherung der durch Rekuperation gewonnenen Energie zuständig und versorgt damit den Akku.
- Der Elektromotor: Der Elektromotor des E-Autos ist ein synchroner Wechselstrommotor. Dieser besteht aus zwei Elektromagneten, einem Stator sowie einem Rotor. Der Rotor erzeugt ein Magnetfeld durch Wechselstrom, während der Stator ein konstantes Magnetfeld durch Gleichstromfluss produziert, das immergleiche Ladung gewährleistet. Das Wechselstrom-Magnetfeld hingegen ändert seine Ladung periodisch und es kommt zum abwechselnden Anziehen und Abstoßen der Elektromagneten. Der Rotor dreht sich und setzt das Fahrzeug in Bewegung.
- Der Ladeanschluss: Der Ladeanschluss ist der Teil des E-Autos, über den man besagtes auflädt. Dies geschieht entweder an öffentlichen Ladestationen, portablen Ladegeräten oder privaten Wallboxen. Hierbei wird Wechselstrom des Stromnetzes in den für das E-Auto notwendigen Gleichstrom umgewandelt.
- Das Kühlsystem: Um die Leistung des E-Autos zu sichern, müssen Batterie, Motor und Leistungselektronik im optimalen Temperaturbereich gehalten werden. Kühlung und Heizung des Autos werden durch das Thermomanagement-System generiert.
Ebenfalls interessant
Die magnetische Kraft, die hier für die Wechselwirkung und die Bewegung sorgt, nennt sich Lorentzkraft.
Auch interessant: Die 8 besten E-Bikes für den Alltag
Die Vor- und Nachteile eines E-Autos
Bei Elektroautos gibt es Vor- und Nachteile. Nachfolgend erfahren Sie zunächst die Vorzüge eines E-Autos:
Vorteile
- Lautstärke: Während die Abrollgeräusche bei Verbrennungs- und Elektromotoren gleich sind, ist die Lautstärke des Elektromotors bei einem E-Auto deutlich geringer als bei anderen Modellen.
- Umweltschutz: Ein Elektroauto besitzt keinen klassischen Auspuff und erzeugt so auch keine Abgase. Ohne CO2-Emissionen tragen Elektromotoren also positiv zum Umweltschutz bei.
- Geringe Betriebskosten: Die Ölpreise steigen und Auto fahren wird zum Luxus. Bei dieser Problematik greifen E-Autos, denn sie benötigen kein Benzin, sondern lediglich Strom – und dieser steht etwas günstiger zur Verfügung. Einige Firmen, Restaurants oder Hotels bieten kostenloses Laden für Kunden an, aber auch an Ladestationen bezahlt man verhältnismäßig wenig. Ob sich ein E-Auto im Vergleich zum Benziner oder Diesel rechnet, hängt aber auch von der Fahrweise und Nutzung ab.
- Kaum Reparaturen: Elektroautos haben wenige verschleißanfällige Bauteile. Kupplung oder Auspuff gibt es nicht und müssen somit auch nicht repariert oder ersetzt werden. Auch die Wartungskosten halten sich in Grenzen und sind Schätzungen zufolge um bis zu einem Drittel geringer als bei Verbrennungsmotoren.
- Staatliche Förderungen: Um die Umweltbelastung zu senken, fördert der Staat den Kauf von E-Autos und bietet Zuschüsse. Umweltbonus und Innovationsprämie ermöglichten noch bis Ende 2022 eine Förderung von bis zu 9000 Euro bei reinen E-Autos. Mittlerweile liegt die Förderungssumme durch Staat und teils Hersteller bei bis zu 6750 Euro. Seit 2023 fällt die Förderung für Plug-in-Hybride jedoch weg und beschränkt sich auf rein batterieelektrische sowie Brennstoffzellenfahrzeuge.
Den Vorteilen von E-Autos stehen aber auch Nachteile gegenüber. Und die zeigen sich wie folgt:
Nachteile
- Begrenzte Reichweite und lange Ladezeiten: Langstreckenfahrten sind mit einem E-Auto noch kaum möglich. Trotz Schnellladefunktion muss ein Elektroauto einige Zeit an der Ladestation verweilen. Zwischen den Herstellern und Modellen fällt die Ladezeit unterschiedlich aus, komplett zu vermeiden ist sie aber nicht. Die Reichweite ist bei E-Autos außerdem geringer, wodurch häufiger geladen werden muss, als Verbrennungsmotoren getankt werden müssen.
- Mangel an Ladestationen: Die deutsche Infrastruktur bietet momentan noch nicht ausreichend viele Ladestationen flächendeckend an. Wer während einer Reise spontan laden will, muss sich erst auf die Suche nach Stationen begeben, von denen eventuell nicht ausreichend vorhanden oder die vorhandenen besetzt sein können.
- Höhere Anschaffungskosten: Ein Elektroauto ist in der Anschaffung teurer als Benziner und Dieselfahrzeuge. Dank der staatlichen Förderung gibt es aber auch Modelle, die günstiger sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Für wen lohnt es sich, dieses Jahr ein Elektro-Auto zu kaufen?

Die Vor- und Nachteile eines E-Kennzeichens beim Auto

So hält die Batterie in E-Autos länger
Fazit
Ein schrittweiser Umstieg auf ein Elektroauto ist nicht zu vermeiden. Mit dem Beschluss der EU ist festgelegt, dass ab 2035 ausschließlich elektronisch betriebene Neuwagen angeboten werden dürfen. Viele Hersteller gehen schon mit dem Wandel und sorgen dafür, dass der Markt an E-Autos stetig wächst. Der Kauf eines Elektroautos ist also für viele ein sinnvoller nächster Schritt.
Magnetismus und Lorentzkraft – Der Elektromotor bietet dem Verbrennungsmotor gegenüber viele Vorteile. Er ist leiser, effizienter, leistungsdichter. Geld spart man sowohl bei der Wartung sowie seltenen Reparaturen als auch beim Laden.
Besonders komfortabel ist eine Ladung zu Hause, ansonsten stehen Ladestationen zur Verfügung. Hier unterscheidet man in reguläre AC-Ladung und schnelle DC-Ladung. Diese kann man über das bordeigene Navigationssystem oder über passende Apps ausfindig machen. Problematisch wird es, wenn die Ladestationen besetzt sind: Da das Laden länger dauert als ein herkömmlicher Tankvorgang, ist eine besetzte Ladesäule für längere Zeit nicht brauchbar. Auch besteht die Gefahr, dass nicht elektrisch betriebene Autos an den Ladestationen parken und diese versperren.
Dank Strom aus erneuerbaren Energien und dem Wegfallen von CO2-Emissionen während der Fahrt, wird das E-Auto zum Klimaschützer. Lediglich in der Produktion wird viel CO2 frei, was aber mit jedem Kilometer Fahrt ausgeglichen wird.
Teure Anschaffung mit vielen Vorteilen: Aufgrund des EU-Beschlusses ist ein Umstieg auf ein Elektroauto sinnvoll und mit Blick auf das Klima wichtig. Elektromotoren sind – nach heutigem Stand und öffentlichen Meinungen – die Zukunft der Mobilität. Wer hier mitwirken will, sollte den Kauf eines E-Autos in Betracht ziehen.

