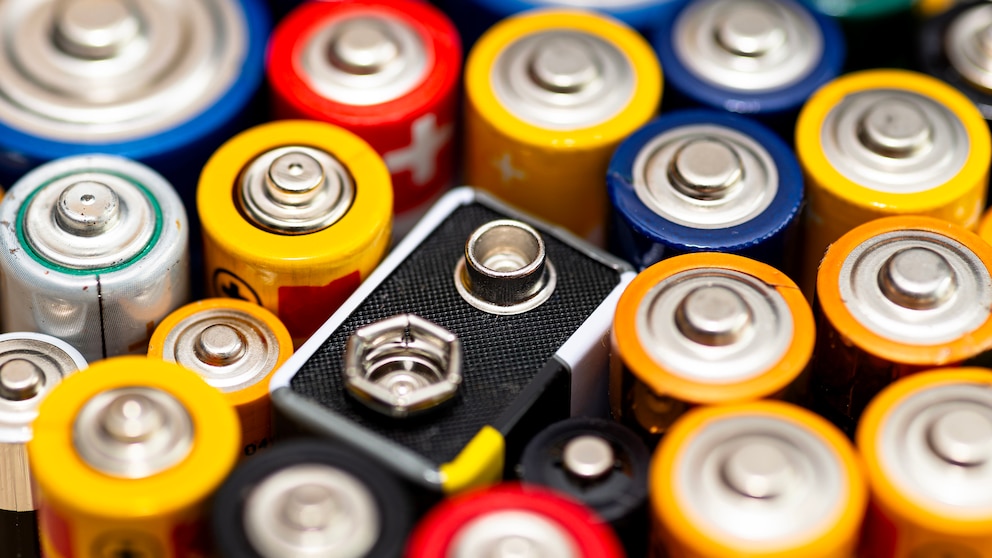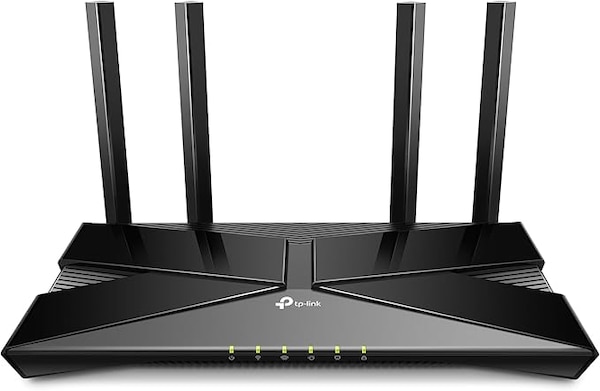3. Mai 2025, 9:40 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Ob im Wecker, Spielzeug oder in der Taschenlampe – Batterien sind aus dem Alltag kaum wegzudenken. Doch nicht jede Batterie ist für jedes Gerät geeignet. Besonders zwischen Lithium- und Alkalibatterien gibt es Unterschiede, die beim Kauf eine wichtige Rolle spielen können.
Lithium- und Alkalibatterien zählen zu den am häufigsten verwendeten Batterietypen im Haushalt. Sie unterscheiden sich nicht nur in der chemischen Zusammensetzung, sondern auch in Leistung, Lebensdauer, Gewicht und Umweltverträglichkeit. Während Lithiumbatterien durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturen punkten, sind Alkalibatterien vor allem im Niedrigverbrauchsbereich weit verbreitet. Für welchen Einsatz eignet sich also welcher Batterietyp?
Übersicht
Unterschiede in Bauweise und Leistung
Lithium- und Alkalibatterien sind in vielen Fällen in denselben Formen erhältlich, sie lassen sich also in entsprechenden Geräten gleichermaßen einsetzen. Angeboten werden sie zumeist in den gängigen Standardgrößen:
- AA (Mignon)
- AAA (Micro)
- C
- D
- 9V-Block
- Knopfzelle
Der Unterschied liegt jedoch in ihrer chemischen Zusammensetzung sowie in ihrer Spannung. Alkalibatterien (Alkaline) basieren auf Zink als Anode (Minuspol), Mangandioxid als Kathode (Pluspol) und alkalische Elektrolyte wie Kaliumhydroxid. Letzteres gibt den Batterien ihren Namen. Sie sind vergleichsweise einfach herzustellen, kostengünstig und lassen sich mit im Schnitt 10 Jahren lange lagern. Die Dichte von Alkalibatterien beträgt 90–130 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg), die Spannung 1,5 Volt. Daher eignen sich diese Batterien insbesondere für Geräte mit konstant niedrigem Energiebedarf wie Wanduhren, Fernbedienungen oder Rauchmelder.
Lithiumbatterien bestehen aus metallischem Lithium als Anode, Mangandioxid oder Eisensulfid als Kathode und einem organischen Elektrolyt. Sie lassen sich hervorragend lagern, haben eine geringe Selbstentladung und eine hohe Energiedichte von 250 bis 300 Wh/kg. Ihre Spannung liegt meist bei 1,75 Volt oder mehr, was eine höhere Leistung bedeutet – etwa für Taschenlampen oder Kameras. Lithiumbatterien lassen sich in der Regel als direkter Ersatz für Alkalibatterien verwenden.
Lesen Sie auch: Darum laufen Batterien manchmal aus
Wiederaufladbare Versionen
Alkalibatterien gibt es auch als wiederaufladbare Variante, die allerdings nicht sehr weit verbreitet ist. Die chemische Zusammensetzung ist in diesem Fall leicht verändert. Wiederaufladbare Alkalibatterien punkten durch eine geringe Selbstentladung, haben allerdings einen begrenzten Lebenszyklus von nur 50–100 Ladezyklen.
Auch bei Lithium gibt es wiederaufladbare Versionen, die deutlich bekannter sind als die der Alkalibatterie. Man unterscheidet in Lithium-Ionen-Akkus und Lithium-Polymer-Akkus, die jedoch nicht mehr die gängige Batterieform für den Haushaltseinsatz haben. Lithium-Ionen-Akkus bestehen aus Graphit, Lithium-Metalloxid sowie einem organischen Lösungsmittel mit Lithiumsalz als Elektrolyt. Sie haben eine hohe Energiedichte, erlauben viele Ladezyklen und haben keinen Memory-Effekt, sind aber empfindlich gegen Überladung und Hitze. Eingesetzt werden Lithium-Ionen-Akkus oft in Smartphones, Laptops, E-Bikes, Elektroautos.
Lithium-Polymer-Akkus haben im Inneren ein Gel oder einen Feststoff (polymerbasiert) statt Flüssigkeit und oft ein flexibles und sehr leichtes Gehäuse. Sie kommen daher in dünnen Geräten wie Tablets oder Smartwatches sowie in Drohnen oder im Modellbau zum Einsatz.
Bei der Lebensdauer haben Lithiumbatterien die Nase vorn
Ein wesentlicher Vorteil von Lithiumbatterien ist ihre deutlich längere Lebensdauer. Sie bieten Laufzeiten von 2 bis 4 Stunden und eine höhere Zykluslebensdauer von 500 bis 1000 Ladezyklen. Ihre geringe Selbstentladung (<2 Prozent pro Monat) und schnelle Ladezeit (1–3 Stunden) machen sie besonders zuverlässig. Zudem halten Lithiumbatterien ihre Kapazität auch bei niedrigen Temperaturen und eignen sich daher gut für den Außeneinsatz, etwa in Überwachungsanlagen oder Ortungssystemen.
Lesen Sie auch: Genialer Trick zeigt in Sekunden, ob Batterien leer oder voll sind
Alkalibatterien dagegen sind günstiger in der Anschaffung und ausreichend für weniger energieintensive Anwendungen im Innenbereich. Sie laufen meist nur 1 bis 2 Stunden, leiden unter dem sogenannten Memory-Effekt und entladen sich schneller. Auch die Ladezeiten sind mit 4 bis 8 Stunden deutlich höher, was sie weniger geeignet für Hochleistungsgeräte macht.
Anwendungsgebiete im Überblick
Lithiumbatterien:
Ideal für tragbare Elektronik (Smartphones, Tablets), Elektrowerkzeuge, Elektrofahrzeuge, Drohnen und fahrerlose Transportsysteme. Sie bieten hohe Energiedichte, schnelle Ladezyklen und lange Lebensdauer.
Alkalibatterien:
Geeignet für Uhren, Fernbedienungen, Spielzeuge und Taschenlampen – also Geräte mit niedrigem Stromverbrauch und seltener Nutzung.
Welche Batterie ist besser für die Umwelt?
Beide Batterietypen enthalten Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung umweltschädlich sein können. Während Lithiumbatterien als giftig eingestuft werden, gelten Alkalibatterien als weniger schädlich. Dennoch gilt für alle Batterien: Sie gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammelboxen. Die neue EU-Verordnung, die seit 18. Februar 2024 gilt, schreibt strengere Grenzwerte für Quecksilber und Cadmium vor und verpflichtet Hersteller zu mehr Transparenz und Recycling.
Die Herstellung von Lithiumbatterien ist aufgrund teurer Rohstoffe wie Kobalt kostenintensiv. Trotz höherer Anschaffungskosten gelten sie wegen ihrer Langlebigkeit jedoch als wirtschaftlicher. Im Vergleich dazu sind Alkalibatterien in der Produktion günstiger, müssen aber häufiger ersetzt werden – was langfristig höhere Gesamtkosten verursachen kann.
Für Geräte mit hoher Nutzung und Energiebedarf wie Elektrowerkzeuge oder Drohnen sind Lithiumbatterien somit kosteneffizienter. Für gelegentlich genutzte Geräte wie Fernbedienungen bieten Alkalibatterien einen Preisvorteil.

Worauf man bei E-Auto-Akkus achten sollte

Mit dieser Technik lädt Ihr Akku in wenigen Minuten

Wie wir unsere Geräte bald in 20 Sekunden aufladen
Lithium- oder Alkalibatterien? Fazit für den Alltag
Für gelegentliche Anwendungen in einfachen Geräten reichen Alkalibatterien aus. Wer jedoch Wert auf Leistung, Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit legt, greift besser zu Lithiumbatterien. Unabhängig vom Typ ist eine sachgemäße Entsorgung unerlässlich, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Die neue EU-Verordnung trägt dazu bei, Batterien nachhaltiger zu machen und den Ressourcenverbrauch zu senken.